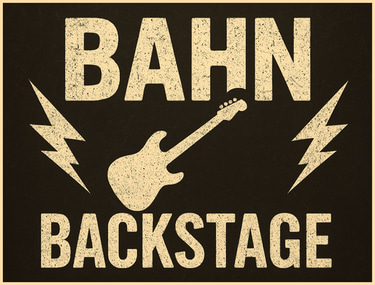'Money for Nothing' - Dire Straits
Der große Hit der Dire Straits entstand wie das gesamte Album "Brothers in Arms" auf der Karibik-Insel Montserrat. Ein besonders kreativer Ort.
SONGS
UWE BAHN
7/28/2025
Es ist der Song mit einem Jahrhundert-Riff. Kein wildes Gitarrengemetzel, kein aufgebrezelter Synthie – sondern ein trockener, punchiger Brocken, den Mark Knopfler da raushaut, als hätte er ihn direkt mit der Hand aus einem Betonblock gemeißelt. „Money for nothing“ – der Titel, mit dem die Dire Straits 1985 MTV-Ikonen wurden und gleichzeitig mit der ironischen Abrissbirne durchs Musikfernsehen marschierten.
Was viele nicht wissen: Der legendäre Text stammt nicht aus Knopflers Feder, sondern fast wortwörtlich aus dem Mund eines genervten Möbelfachverkäufers. Knopfler stand in einem Elektromarkt in New York, als neben ihm ein Angestellter begann, über die Typen aus dem Fernseher zu schimpfen – diese “Millionärs-Rockstars, die nur rumhüpfen und dafür Geld kriegen“. Knopfler hörte zu, grinste – und schrieb’s auf. Authentischer kann Sozialkommentar nicht sein.
Hitstudio in der Karibik
Musikalisch wurde „Money for nothing“ in einem der wohl abgelegensten Tonstudios der Popgeschichte geboren: den AIR Studios Montserrat. George Martin – der Beatles-Produzent – hatte das Studio auf der Karibikinsel gegründet. Zwischen Palmen, Hurrikans und britischem Teatime-Charme entstanden dort Meilensteine von The Police, Elton John und eben den Dire Straits, sogar deren ganzes Meisterwerk "Brothers in Arms". Die tropische Isolation tat dem Sound hörbar gut. Klar, frisch, fast luftig – und doch gnadenlos auf den Punkt.
Und dann ist da noch Sting. Der singt den Refrain – dieses berühmte „I want my MTV“ – fast beiläufig, als würde er in der Hotellobby auf seinen Mojito warten. Er machte gerade Urlaub auf Montserrat und Kumpel Knopfler (beide wuchsen in Newcastle auf) liess ihn zum Einsingen ins Air Studio kommen. Offiziell als Co-Autor gelistet, kassiert er bis heute mit. Money for… something.
„Money for nothing“ ist mehr als nur ein Hit. Es ist ein Statement aus der Mitte der 80er, zwischen Medienkritik, Pop-Ikonografie und einem trockenen Händedruck aus der Arbeiterklasse. Und es zeigt, dass ein guter Song manchmal nicht im Studio entsteht – sondern im Elektromarkt, zwischen Kühlschränken und Grantlern. Und auf einer Karibikinsel.